Themenfelder
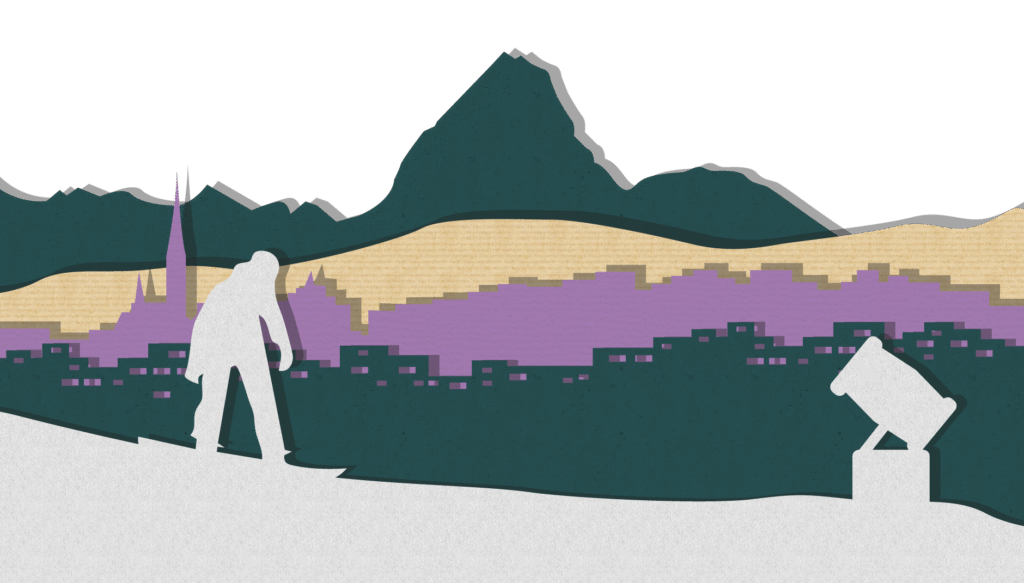
Der 5. Landschaftskongress stellt Landschaftsbeziehungen in den Fokus. Er lädt alle landschaftsrelevanten Forschungsrichtungen, Praxis- und Politikfelder ein, mit unterschiedlichen Herangehens-, Denk- und Handlungsweisen miteinander zu diskutieren und in den Austausch zu treten. Die Themenfelder reichen von Literatur bis Regionalwirtschaft, von Identität bis Naturgefahren.
01: Alpen und Unterland zwischen Stadt- und Landflucht
Welchen Einfluss haben (temporäre) Abwanderung und multilokales Wohnen auf die räumliche Identifikation in verschiedenen Landschaftstypen? Was bedeutet multilokales Arbeiten und Wohnen für die wirtschaftliche Entwicklung der Bergregionen? Welchen Einfluss nehmen neue Arbeits- und Mobilitätsformen auf die Landschaft? Wie bedingen umgekehrt landschaftliche Veränderungen unsere Lebensweisen?
02: Auswirkungen von Fremd- und Selbstbestimmung auf räumliche Identität und Landschaft
Wie werden politische und wirtschaftliche Selbst- und Fremdbestimmung in Alpen und Unterland wahrgenommen? Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen verschiedenen Regionen? Und wie wirkt sich dies auf regionale Identitäten, politische und wirtschaftliche Beziehungen sowie auf die Landschaftsentwicklung aus?
03: Auswirkungen der Schweiz auf Landschaften andernorts und umgekehrt
Welche Auswirkung haben Lebensstile und Konsumpraktiken in der Schweiz auf die Landschaften in fernen Produktionsländern? Welche Auswirkungen haben internationale politische und wirtschaftliche Verflechtungen auf die Landschaftsentwicklung in der Schweiz?
04: Landschaftsverständnisse gestern, heute, morgen
Wie hat sich die Wahrnehmung spezifischer Landschaften verändert, insbesondere auch im Zeichen des Klimawandels und von demographischen Veränderungen? Was gewinnen wir bzgl. Landschaftsentwicklung und -politik, wenn Landschaft als Beziehungsgeflecht verstanden wird? Welche Chancen bietet die Überwindung der Dichotomie zwischen Kultur und Natur im Landschaftsdiskurs, insbesondere in den Alpen?
05: Bedrohung, Idylle, Abenteuer, Freiheit: Alpenlandschaft als Projektionsfläche in Kunst, Literatur und Film
Wie werden Alpen und Berge in Filmen, Literatur, Kunst und Popkultur beschrieben? Wie steht dies im Verhältnis zur Darstellung von Städten? Wie hat sich dies mit anderen gesellschaftlichen Veränderungen gewandelt?
06: Bildung und Vermittlung von, in, mit und über Landschaft
Wie lassen sich in der schulischen und ausserschulischen Bildung persönliche Beziehungen zu Landschaft aufbauen? Wie lässt sich der Landschaftsansatz im Unterricht stärken? Was kann die Landschaftsbildung von der Bildung für Nachhaltige Entwicklung lernen?
07: Dialoge zwischen Akteur:innen über und zwischen Landschaften
Wie gelingt ein Dialog zwischen Akteur:innen von Räumen, deren Beziehung als spannungsreich wahrgenommenen wird (Siedlungs-/Naturraum, Zentrum/Peripherie, Berg/Tal)? Wie lassen sich Dialoge fördern, bspw. zwischen Ein- und Zweitheimischen? Wer beteiligt sich (nicht) an Landschaftsdiskursen?
08: Landschaftsgestaltung: planen, bauen, entwickeln in den Bergen und im Unterland
Was bedeutet nachhaltige Stadt- und Landschaftsentwicklung in den Bergen und im Unterland? Welche Rahmenbedingungen definieren Planungsprozesse? Welche Machtbeziehungen spielen in Planungsprozessen? Welche Bedeutung haben lokale Eigeninitiativen in Berg und Tal? Wie unterscheiden sich Bauprozesse in Berg und Tal? Welche Bedeutungen spielen räumliche Beziehungen bei Gestaltung, Wiederherstellung, Aufwertung und Rückbau?
09: Beziehungen zwischen Landschafts- und Baukultur
Wie kann in Planungs- und Bauprozessen hohe Bau- und Landschaftskultur geschaffen werden? Welchen Beitrag leistet das Davos Qualitätssystem für eine hohe Baukultur für die Berücksichtigung von Landschaftsqualität beim Planen und Bauen? Welche Bedeutung hat die Landschaftskultur für die Baukultur und umgekehrt? Welche Bedeutung hat die regionale Vielfalt für die Landschaftsqualität?
10: Regionalentwicklung in den Alpen und ausserhalb
Was brauchen Bergregionen für ihre wirtschaftliche Entwicklung? Und welche Rolle spielen dabei bestehende Förderinstrumente? Welche Rolle kann und soll dabei die Beziehung zwischen Alpen und Unterland spielen? Wo finden sich Synergien zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Landschaftsqualität und Biodiversität?
11: Pärke als Modellregionen für wirtschaftliche, gesellschaftliche, ökologische und landschaftliche Entwicklung
Welche Rolle spielt ein Park für den Tourismus und die regionalwirtschaftliche Entwicklung in den Alpen und ausserhalb? Wie wirkt die Zertifizierung als Park auf die regionale Identität? Welche unterschiedlichen Potentiale bieten Regionale Naturpärke, potentielle neue Nationalpärke und der Schweizerische Nationalpark?
12: Alp-, Land- und Forstwirtschaft im Wandel
Welche Herausforderungen und Lösungsansätze bestehen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe? Wie verändern klimaangepasste land- und forstwirtschaftliche Produktionssysteme Landnutzung und Landschaft? Wie lässt sich die Alp als Geflecht verschiedener Tier- und Pflanzenarten verstehen? Was ist die Bedeutung einer regionalen Kreislaufwirtschaft für die Biodiversität, Landschaftsqualität und die Regionalentwicklung?
13: Ökologische Infrastruktur, Biodiversität und Landschaft
Wie wirken sich veränderte Nutzungen von Landschaften auf Ökologie und Biodiversität aus? Welche Rolle spielen dabei klimatische Veränderungen? Wie kann die ökologische Infrastruktur sektorenübergreifend umgesetzt werden? Wie hängen Biodiversität und (menschliche) Gesundheit zusammen?
14: Erholung und Gesundheit in der Landschaft
Welche Erholung wird in den Bergen gesucht? Mit welcher Landschaftsgestaltung kann Erholung und Gesundheit in Alpen- und Metropolitanregionen gefördert werden? Welche Bedeutung hatte und hat der Kur- und Gesundheitstourismus im Bergtourismus und speziell in Davos? Erhält der Gesundheitsaspekt im Tourismus mit der Hitzeflucht neue Bedeutungen? Welche Bedeutungen haben Formen des Slow Tourism wie das Waldbaden für die Landschaft?
15: Tourismus und Infrastruktur in der Landschaft
Welche Herausforderungen und Chancen bringt der Tourismus in die Alpen? Welche Rolle spielen Landschafts- und Baukultur, aber auch touristische Anlagen wie Beschneiungsanlagen, Bahnen, Biketrails, Wanderwege usw. für Angebot und Nachfrage? Braucht es Besucherlenkung – nur bei Overtourism oder generell? Wie lassen sich veraltete oder aufgegebene touristische Anlagen umnutzen oder rückbauen?
16: Infrastruktur und Mobilität – die Verbindung von Alpen und Unterland, Stadt und Land
Wie hängen Alpen und Verkehr (historisch) zusammen? Was bedeutet der Freizeit- und Pendelverkehr im Alpenraum und in Transitregionen? Welchen Einfluss hat die Erreichbarkeit auf Freizeit- und Tourismusverkehr? Wie werden Verkehrs-, touristische und ökologische Infrastruktur aufeinander abgestimmt? Wie können die Besucherströme über die Mobilitätsinfrastruktur gelenkt werden? Wer hat das Recht auf welche Infrastrukturnutzung? Wie wirkt die Aufteilung auf verschiedene Verkehrssysteme (Strasse, Bahn, Luft, etc.) auf die Landschaft?
17: Energieproduktion und landschaftliche Auswirkungen
Welche Bedeutung haben die Alpen als Energieproduzent der Schweiz? Wie verändert sich die Wahrnehmung der Wasserkraft, der Wind- und Solarenergie? Welche Rolle spielen Natur- und Landschaftsschutz dabei? Wie können Zielkonflikte zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen und neuen Wildnisstrategien angegangen werden?
18: Klimawandel und Landschaft
Wie verändern sich verschiedene Landschaftstypen im Rahmen des Klimawandels (bspw. Gletscherrückzug, neue Karseen, usw.)? Welche ökologischen Veränderungen sind zu erwarten? Was bedeuten die heisser werdenden Sommer für Einheimische und Besuchende der Alpen- und der Metropolitanregionen? Welche Rolle spielen die Alpen als Wasserspeicher? Welche klimagerechte Landschafts- und Siedlungsentwicklung brauchen wir in Berg und Tal? Was lässt sich in Sachen Klimaanpassung für und von anderen Regionen lernen?
19: Naturgefahren – (nicht nur) ein Faktor der Landschaftsentwicklung
Welche Prognosen und Risiken bestehen – insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel? Wie verändern sich Landschaften mit Naturgefahren und ihrer Prävention (bspw. Lawinenverbauungen usw.)? Welche Chancen bietet das Denken von der Landschaft her für den Umgang mit Naturgefahren?
20: Siedlungsentwicklung im Zeichen veränderter Naturgefahren
Was bedeuten Naturgefahren-Prognosen für die Besiedlung? Wann sind ein Wiederaufbau von zerstörten Siedlungen (bspw. Blatten), Schutzbauten nach Teilzerstörung (bspw. Bondo) – sinnvoll, wann Rückzug und Umsiedlung? Wie sollen gegebenenfalls ein Wiederaufbau und Schutzbauten ausgeführt werden? Wer trifft wann welche Entscheidungen darüber?
Hier gehts zu den Informationen zur zu den Beiträgen.